
 |
Archiv
2005 |




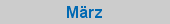   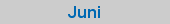 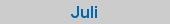 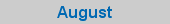 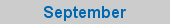 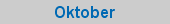 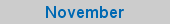 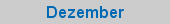
|
|
März
|
|
|
|
  
Presse-Echo

Marbacher
Zeitung 05.03.05



|
|
April
|

|
|
Vögel
der Streuobstwiese 
Bald
ist es wieder soweit, dass in Großbottwar die traditionelle
Vogelführung stattfindet. Auf einem unterhaltsamen Rundgang
wird den Besuchern
Einblick in die Vogelwelt der Streuobstwiesen nördlich von
Großbottwar gewährt.
Neben den Standvögeln wie Kohlmeisen und Amseln,
welche den Winter hier verbracht
haben, werden schon viele Zugvögel aus dem Winterquartier
zurückgekehrt sein
und durch den Gesang ihr Revier markieren. Vor
fünfzig Jahren lebten auf den Großbottwarer
Streuobstwiesen noch
Wiedehopf und Raubwürger, und oben am Waldrand vom Benning
sang damals noch die
Heidelerche. Aber auch das Rebhuhn wird leider seit einigen Jahren
nicht mehr
gesehen. Durch die moderne Landwirtschaft haben diese Tiere keine
Lebensgrundlagen mehr.
Trotz
aller Probleme ist es immer wieder überraschend,
einen Gartenrotschwanz
oder einen Wendehals im Frühjahr zu
beobachten.
Der NABU
Großbottwar lädt ein
zu einer Wanderung unter der
Leitung von Herrn
Willi Leible.
Termin:
Sonntag, 10.04.2005
Treffpunkt:
7.30 Uhr Reithalle Großbottwar
Jahreshauptversammlung
Am
Dienstag, 12.
April 2005 findet um
19:30 Uhr in der VfR-Gaststätte Am Stockbrunnen die
Jahreshauptversammlung
statt.
Tagesordnung:
- Begrüßung
und Bericht des
Vorsitzenden
- Bericht
über die Kassenführung
- Bericht
über die Kassenprüfung
- Entlastung
- Wahlen
Alle
Mitglieder der Ortsgruppe sind zu dieser Versammlung recht herzlich
eingeladen.


|
|
Mai
|
|
     |
|
Vögel
im Lebensraum Talaue
Die
Wiesen im Talbereich
der Bottwar zwischen Großbottwar und
Oberstenfeld
werden nur noch teilweise für die Heugewinnung
genützt. Ein
Großteil der Flächen
befindet sich in öffentlicher Hand. Schon weit zurück
in der
Erinnerung liegt
die Zeit als der Storch bei der
Futtersuche über die Wiesen marschierte und hoch beladene
Heuwagen, gezogen von
einem Pferde- oder Kuhgespann, durch das Tal schwankten.
Es
haben sich nun im Lauf der Jahrzehnte verschiedene Sukzessionsstufen
der Vegetation herausgebildet. Vorhanden sind Mähwiesen,
Seggenbestände,
Gehölzstrukturen
und Schilfröhrichte. Durch diese verschiedenen
Biotoptypen
entstanden
auch für Vögel attraktive
Lebensräume. In
den
Seggenbeständen und Staudenfluren des Gebietes kann der
Feldschwirl angetroffen
werden. Die grössern Verschilfungsinseln im Gebiet werden von
Teichrohrsängern
besiedelt. Die Rohrammer ist an den Rändern jedes
grösseren
Schilfbestandes
anzutreffen. Sie ist typisch für das im Hoftal
häufige
Gemisch aus den Biotoptypen
Schilfröhrichte, Seggenriede, Hochstaudenfluren und einzelnen
Gehölzen.
Der
NABU Großbottwar will auch in
diesem Jahr wieder durch eine Führung einen Einblick
in den Lebensraum Talaue anbieten. Der Weg wurde so
gewählt, daß
auch Familien mit dem Kinderwagen mitwandern können.
Der NABU
Großbottwar lädt
zu dieser Wanderung unter der Leitung von Tobias Pantle und
André Lebherz
ein.
Treffpunkt:
Sonntag 8.5. um 7.30 Uhr,
Parkplatz der Firma Lidl in
Großbottwar

|
|
Juni
|
|
Bienenfresser
Sie
gehören zu den Sommertagen im Midi, wie der blaue
Himmel und die am Abend, mit schrillen Rufen jagenden Mauersegler.
Bevor die
Bienenfresser am Himmel sichtbar werden, sind zunächst nur
ihre Rufe zu hören.
Sie
sind
Sommergäste im Süden Frankreichs, bauen in
Steilwände bis zu drei Meter lange Niströhren, in
denen sie ihre Jungen
großziehen. Die alten Niströhren werden in den
Folgejahren zum Teil von
Steinsperlingen und Staren bewohnt.
Der
Lebensraum der Bienenfresser zwischen dem
Mittelmeer und den Hochflächen der Causses ist die offene
Landschaft der
Weinfelder und Brachflächen mit einzeln stehenden
Bäumen, möglichst mit dürren
Ästen, von denen sie nach Insekten Ausschau halten. Seit
der
Uhu in einem Seitental des Herault nistet
sind die dortigen Bruthöhlen
der
Bienenfresser verlassen, doch an den Sommertagen sind immer wieder
kleine
Trupps bei der Nahrungssuche zu beobachten.
|
|


|
|
Juli
|
|
   |
|
|
|
|
|
Schleiereulen in
Großbottwar
In
Großbottwar, Winzerhausen, Holzweilerhof und Hof und Lembach
wurden vom NABU im Lauf der Jahre insgesamt 16
Schleiereulenkästen
in Gebäude eingebaut oder auch Fertigkästen
angebracht. Der Schleiereulenbestand hat sich in den letzten
Jahren gut entwickelt. Im Durchschnitt kamen 16 Jungeulen / Jahr zum
Ausflug.
Die Schleiereule, eine ursprünglich in warmen Gebieten lebende
Art, ist an schneereiche Winter nur schlecht angepaßt. Das
Fettpolster reicht nur etwa 8 Tage zum Überleben. Die
Schleiereulen sind dann auf Scheunen, in
denen Mäuse vorkommen, angewiesen aber diese sind heute sehr
selten
geworden. In Zeiten der
bäuerlichen Landwirtschaft war dies noch anders, da konnten
die
Schleiereulen auch innerhalb der Gebäude im Winter mal eine
Maus
ergreifen.
Leider ist nun durch den letzten schneereichen Winter der
Schleiereulenbestand stark dezimiert worden. Viele
Altvögel sind infolge Futtermangel umgekommen. Es
wurde
daher in
Großbottwar in diesem Jahr nur eine Brut mit sechs
Jungen
einem Bauernhof im Sauserhof großgezogen.
Allen
Eigentümern,
die einen Schleiereulenkasten in ihr Gebäude einbauen
ließen
sei Dank gesagt und auch für das Interesse, das sie ihren
Schleiereulen
entgegenbringen.


|
|
August |
|
  |
|
Das
Lied der Zikaden
"Sie sind
zu laut. Sie
stören unsere Mittagsruhe. Sie sollen schweigen." So
beklagten sich Camper im Süden Frankreichs beim
Bürgermeister über die Lärmverursacher. Die
Zikaden sind
13-30 mm große Insekten die nur selten zu sehen, aber an
warmen
Tagen
fast immer zu
hören sind. Das überirdische Dasein der Insekten ist
kurz.
Nur zwei bis drei Wochen verleiben den
Zikadenmännchen
für ihre Gesänge. Den weitaus längeren Teil
ihres Lebens
haben sie zuvor unter der Erdoberfläche verbracht.
Das
Weibchen legte ein Ei an der Rinde eines Baumes ab, die
geschlüpfte Larve lässt sich auf den Boden fallen,
gräbt
sich ein und saugt mehrere Jahre an den Wurzeln bis sie an einem Baum
emporkriecht und sich aus der verpuppten Larve das fertige Insekt
entwickelt hat.
Das Lied der Zikaden gehört in den Monaten Juli und
August zum Süden, wie die Sonne und das
Wasser.
Wenn
Sie die
Zikade hören möchten klicken
Sie auf das "Das
Lied der Zikaden" sofern
erforderlich
klicken Sie im Internet Explorer weiter auf│
Informationsleiste│Geblockte Inhalte
zulassen ...│ Ja│←zurück


|
| September
|
|

Zwischen
Wald und
Weinbergen
Die
Berge des
Bottwartales sind Ausläufer der
Löwensteiner Berge. Diese Keuperberge sind an der
Südseite
mit Reben bestockt. Die Berghöhen und die nach Norden
abfallenden
Hänge sind bewaldet. Wunnenstein und Forstberg sind
herauspräparierte Zeugenberge während bei Harzberg
und
Benning über einen Höhenrücken noch ein
Zusammenhang zu
den Löwensteiner Bergen besteht.
An den Mergelhänge nach Süden und Westen
färben sich
jetzt im Spätsommer die
Trauben. Am Waldrand reifen die Hagebutten. Leider sind am Saum
zwischen Weg und Wald kaum noch Reste
der
ehemaligen Steppenheide zu finden, die nach der letzten Eiszeit die
weiten baumlosen Gebiete überzog. Es gibt auf der Gemarkung
nur
noch wenige Stellen an denen sonnenliebende Kräuter, wie
Karthäusernelke und
Hauhechel, Sonnenröschen und wilder Thymian gedeiht. Die
blühenden Pflanzen werden von Schmetterlingen,
Bienen und
Hummeln
besucht. Am Waldrand sollen keine Feigenbäume wachsen und auch
Hauswurz ist dort am falschen Platz.
Waldbäume
versuchen sich auf diesen Flächen
auszubreiten und
immer wieder werden die Flächen als Lagerplätze
für
Dünger und Brennholz benützt und dadurch die seltenen
Pflanzen geschädigt.
Es ist Aufgabe der Gemeinde dafür zu sorgen, daß der
Wald
zurückgenommen wird und die wertvollen Flächen nicht
zu
Lagerplätzen verkommen.



|


 
|

|
|

|

|
|
|
 |
|
Im
Kleinbottwarer Tal
Es ist schon lange her, daß die Talwiesen in der
bäuerlichen
Landwirtschaft zur Heugewinnung notwendig waren. Anfang des
letzten Jahrhunderts wurde das Gras noch mit der Sense gemäht.
In
den dreißger Jahren ratterten dann die mit Pferden oder
Kühen gezogenen Mähmaschinen durch das Tal.
Später waren
es die Motormäher und dann die Schlepper, mit denen das Gras
gemäht wurde.
Die Zeiten sind vorbei in denen hoch beladene Heuwagen durch das Tal
wankten.
Heute ist die Talaue Landschaftsschutzgebiet und wird nur noch extensiv
als Grünland bewirtschaftet. Einige Bereiche sind 24a Biotope
nach
dem NatSchG, hier sind Tiere und Pflanzen gesetzlich geschützt.
Der Talraum dient auch als Aufenthalts- und Durchzugsgebiet
für viele Vogelarten.
Durchzügler
im Kleinbottwarer Tal
ist Eisvogel und Bekassine.
Das ganze Jahr über suchen hier die Graureiher ihre Nahrung.

|


|
|
|

|
|
|
|
Herbstspaziergang
Im
Bottwartal an den Rebhängen hat
das Laub seine grüne Farbe in
Gelbtöne verwandelt.
Am Straßenrand leuchten rot die Blätter und
Früchte am
Pfaffenhütchenstrauch.
In den Gärten werden die letzten Blüten von
Schmetterlingen und Bienen besucht.
Auf dem Mittelstreifen eines wenig befahrenen Waldweges blühen
noch die Rauhe Nelke und das Tausendgüldenkraut.
Aus den Blüten des Maiglöckchens haben sich rote
Beeren
entwickelt, die aber nicht verzehrt werden dürfen, sie sind
giftig.
In den Streuobstwiesen, am alten Bittenfelderbaum, hängen in
diesem Jahr nur wenige Äpfel, die sich aber prächtig
entwickelt haben.
Solange die Herbsttage noch so schön sind, locken sie hinaus
in
die Natur zum Wandern und Schauen.
|

|
|
|
|
|

|
Text
und Fotos: Karl Pantle |

|
|
|
 Die
Mistel -
vorweihnachtlicher Schmuck
Das
Laub
der Obstbäume hat der Wind verweht. Doch auf einigen
Bäumen unserer Markung sind in den Baumkronen noch
grüne
Laubbüschel
zu finden. Es ist die Mistel, die sich hier eingenistet hat. Aber jetzt
in der Vorweihnachtszeit ist die Pflanze auch als
Schmuckpflanze
in
den
Blumengeschäften zu finden.
Die
Mistel wächst als Halbschmarotzer auf den Bäumen.
Über
Ihre Wurzeln zapft sie die Leitungsbahnen der Bäume an, auf
denen
sie siedelt. Vollschmarotzer beziehen übrigens im Vergleich
zum
Halbschmarotzer ihre gesamten Nährstoffe aus der Wirtspflanze
und
haben auch ihre eigene Photosynthese eingestellt, sie besitzen daher
keine Grünfärbung mehr. Dies ist bei der Mistel nicht
der
Fall.
Die
Namensherkunft ist
ungewiss. Im althochdeutschen hieß die Pflanze mistil, was
soviel
bedeutet wie Mist, bezugnehmend auf die Verbreitung der Samen durch die
Ausscheidung der Vögel. Volkstümlich hatte sie noch
viele
andere Bezeichnungen, so nannte man sie Hexenbesen, Hexenkraut und auch
Donarbesen. Die
Mistel -
vorweihnachtlicher Schmuck
Das
Laub
der Obstbäume hat der Wind verweht. Doch auf einigen
Bäumen unserer Markung sind in den Baumkronen noch
grüne
Laubbüschel
zu finden. Es ist die Mistel, die sich hier eingenistet hat. Aber jetzt
in der Vorweihnachtszeit ist die Pflanze auch als
Schmuckpflanze
in
den
Blumengeschäften zu finden.
Die
Mistel wächst als Halbschmarotzer auf den Bäumen.
Über
Ihre Wurzeln zapft sie die Leitungsbahnen der Bäume an, auf
denen
sie siedelt. Vollschmarotzer beziehen übrigens im Vergleich
zum
Halbschmarotzer ihre gesamten Nährstoffe aus der Wirtspflanze
und
haben auch ihre eigene Photosynthese eingestellt, sie besitzen daher
keine Grünfärbung mehr. Dies ist bei der Mistel nicht
der
Fall.
Die
Namensherkunft ist
ungewiss. Im althochdeutschen hieß die Pflanze mistil, was
soviel
bedeutet wie Mist, bezugnehmend auf die Verbreitung der Samen durch die
Ausscheidung der Vögel. Volkstümlich hatte sie noch
viele
andere Bezeichnungen, so nannte man sie Hexenbesen, Hexenkraut und auch
Donarbesen.
Alles
weitere über die
mit
mystischem Hauch umgebene Pflanze finden sie in folgendem
Link:
Wikipedia

|
|
|
|

|
|
